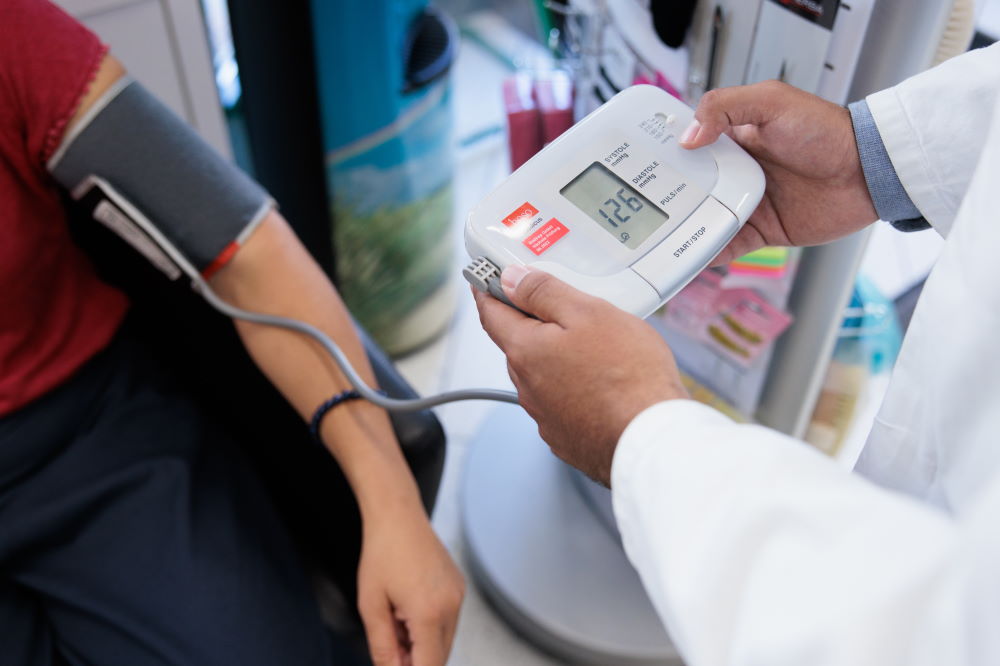Apotheker/in UNI/ETH
Apotheker und Apothekerinnen sind Fachleute für Medikamente und deren Anwendung. Sie kontrollieren ärztliche Rezepte und prüfen, ob verschiedene Medikamente miteinander kompatibel sind. Sie geben Medikamente ab, erklären die Einnahme und mögliche Nebenwirkungen und beraten die Kundschaft zu nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten. In Spitalapotheken sind sie für die Auswahl und Beschaffung der medizinischen Produkte zuständig.
- Bildungstypen
-
Hochschulberuf
- Berufsfelder
-
Gesundheit
- Branchen
-
Ärztliche und wissenschaftliche Funktionen - Chemie, Pharma, Biotechnologie
- Swissdoc
-
0.724.2.0 - 0.724.15.0
Aktualisiert 24.10.2022
Tätigkeiten
Sie üben folgende Tätigkeiten aus:
In der Offizin (öffentliche Apotheke)
- Kunden beraten und bedienen sowie ihre Dossiers verwalten
- Rezepte kontrollieren, Kompatibilität (Verträglichkeit) mehrerer Medikamente überprüfen sowie Kundinnen über Dosierung und Art der Einnahme aufklären
- Arzneimittel gemäss ärztlichen Vorgaben zubereiten, z. B. Sirupe, Lösungen und Salben
- an Kampagnen der öffentlichen Gesundheit teilnehmen und diese mitgestalten, beispielsweise in der Aids- und Suchtmittelprävention, in der Krebsvorsorge oder bei Impfkampagnen
- Ernährungsprodukte und Kosmetik für bestimmte Zielgruppen verkaufen sowie die Kundschaft dazu beraten
- Medikamentenlager verwalten und abgelaufene Produkte umweltgerecht entsorgen
- Apotheke führen sowie Lernende und Mitarbeitende ausbilden und betreuen
Im Spital
- Medikamente für den Spitalbetrieb bestellen, kontrollieren und verteilen
- ein Verzeichnis der abgegebenen Betäubungsmittel führen
- Lager und Vorräte verwalten unter Berücksichtigung der kantonalen Richtlinien und Katastrophenpläne
- Mitarbeitende betreuen und an deren Ausbildung mitwirken, zum Beispiel bei Assistenzärztinnen
- spezielle Präparate nach ärztlicher Verordnung herstellen
- an klinischen Versuchen und Forschungsprojekten mitarbeiten
- an ärztlichen Visiten bei Patienten teilnehmen
In der Forschung und Industrie
- neue pharmazeutische Produkte entwickeln und ihre Wirkung erforschen
- klinische Versuche durchführen, um die Wirksamkeit von Produkten und allfällige Nebenwirkungen zu untersuchen
- Unterlagen für die Zulassungsbehörden erstellen
- Verfahren für die industrielle Herstellung von Produkten entwickeln
- Marktstrategien für Medikamente ausarbeiten
- Expertisen und Kontrollen von pharmazeutischen Produkten aller Art durchführen
Ausbildung
Ausbildungsweg
- Pharmaziestudium mit Masterabschluss und eidg. Diplomprüfung
Hinweis: Um den Beruf in eigener fachlicher Verantwortung ausüben zu können, muss zusätzlich zum Masterabschluss und der eidg. Diplomprüfung ein eidg. Weiterbildungstitel als Fachapotheker/in erlangt werden. Es gibt die Weiterbildung zum/zur Fachapotheker/in in den Fachrichtungen Offizin- oder Spitalpharmazie. Es ist insbesondere im Bereich Offizin üblich und empfehlenswert, die Weiterbildung zum/zur eidg. Fachapotheker/innen Offizinpharmazie zu absolvieren.
Studienorte
- Universitäten Basel, Bern, Genf und ETH Zürich
- 1. Studienjahr: Universitäten Neuenburg und Lausanne
- Alle Angebote ansehen
Dauer
Bachelor- und Masterstudium: 5 Jahre
Studienaufbau (Beispiel)
- Naturwissenschaftliche und biomedizinische Grundlagen: Mathematik, Physik, Chemie, Biologie, Anatomie, Physiologie
- Arzneimittel: Forschung, Wirkungsweise, Herstellung, Anwendung
- Famulatur: 2-wöchiges Praktikum (kann aufgeteilt werden in je 1 Woche öffentliche Apotheke und Spitalapotheke)
- Master: Vertiefung in Pharmazie. Masterarbeit und -prüfung
- Assistenzjahr für angehende Apotheker/innen (30 Wochen Praxis in Offizin und Spital) bzw. Praktikum für angehende Pharmazeut/innen in der Forschung
Abschluss
- Master of Science (UH/ETH) in Pharmacy
- eidg. dipl. Apotheker/in
Voraussetzungen
Vorbildung
- gymnasiale Maturität, Berufsmaturität mit bestandener Passerelle oder Bachelorabschluss (FH, PH, UH, ETH)
Zulassung zum Bildungsgang:
Detaillierte Auskünfte erteilen die Zulassungsstellen der einzelnen Universitäten bzw. der ETH.
Zur dreiteiligen eidg. Diplomprüfung Pharmazie, die nach der bestandenen Masterprüfung an der entsprechenden Hochschule absolviert wird, informiert das Bundesamt für Gesundheit.
Anforderungen
- Interesse am Gesundheitswesen
- analytisch-konzeptionelle Fähigkeiten
- vernetztes Denken und Handeln
- ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein
- sorgfältige Arbeitsweise
- selbstständige Arbeitsweise
Weiterbildung
Eidg. Weiterbildungstitel Fachapotheker/in
- in Offizinpharmazie
- in Spitalpharmazie
Fähigkeitsausweise FPH
Diverse Fähigkeitsausweise in Offizin- und Spitalpharmazie sowie in Komplementärmedizin und Phytotherapie. Zum Beispiel:
- Anamnese in der Grundversorgung
- Impfen und Blutentnahme
- Klinische Pharmazie
- Phytotherapie
Doktorat
Doktorat in Pharmazeutischen Wissenschaften
Nachdiplomstufe
Angebote von Universitäten und ETH, z. B. MAS in Medicines Development, in Medizindidaktik, in Pharmacie hospitalière, in Public Health, in Health Administration oder in Gesundheitsförderung.
Berufsverhältnisse
Apothekerinnen und Apotheker arbeiten eng mit Fachpersonen und Institutionen des öffentlichen Gesundheitswesens zusammen. Ihre Arbeitszeiten sind oftmals regelmässig, sind jedoch abhängig vom konkreten Arbeitsort.
Die meisten Berufsleute arbeiten in einer öffentlichen oder in einer Spitalapotheke. Viele Berufsleute, die diesen Weg einschlagen, absolvieren dann die Weiterbildung als Fachapotheker/in, welche zur Berufsausübung in eigener fachlicher Verantwortung obligatorisch ist. Ohne Fachapotheker/innen-Titel sind weitere Tätigkeitsgebiete die chemische, pharmazeutische und veterinärmedizinische Industrie sowie die Lebensmittel- oder Kosmetikindustrie. Apothekerinnen und Apotheker finden auch Arbeitsmöglichkeiten in der Verwaltung, im humanitären Bereich oder an Universitäten und Hochschulen.
Das Medizinalberufegesetz verpflichtet alle Apotheker und Apothekerinnen, sich kontinuierlich fortzubilden. Die lebenslange Fortbildung stellt sicher, dass ihr Fachwissen und ihre Kompetenzen stets aktuell sind.
Weitere Informationen
Adressen
Schweizerischer Apothekerverband
pharmaSuisse
Stationsstr. 12
3097 Liebefeld
Tel.: +41 31 978 58 58
URL: https://www.pharmasuisse.org
URL: https://choose-your-impact.ch
E-Mail:
Bundesamt für Gesundheit
Schwarzenburgstrasse 157
3003 Bern
Tel.: +41 31 322 21 11
URL: https://www.bag.admin.ch
E-Mail:
Institut für pharmazeutische Weiter- und Fortbildung FPH
Stationsstrasse 12
3097 Liebefeld
URL: https://www.institutfph.ch
E-Mail:
Links
Studienrichtung Pharmazeutische WissenschaftenPorträts von Berufsleuten mit Abschluss Pharmazie
Informationen in anderen Sprachen